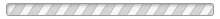
Identifikation (kurz)
Titel
Staatsanwaltschaft beim Sondergericht Altona bzw. Kiel
Laufzeit
1930-1985
Bestandsdaten
Geschichte des Bestandsbildners
Nach Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft 1933 wurden für jeden Oberlandesgerichtsbezirk im Reichsgebiet Sondergerichte eingerichtet. Im Oberlandesgerichtsbezirk Kiel erfolgte die Einrichtung des Sondergerichts beim Landgericht Altona, das ab 1937 im Zuge des Groß-Hamburg-Gesetzes zum Landgericht Kiel verlegt wurde. Die Sondergerichte waren zuständig für Delikte nach der "Reichstagsbrandverordnung" vom 28. Februar 1933 und der "Heimtückeverordnung" vom 21. März 1933 (ab 30. Dezember 1934: "Heimtückegesetz"). Durch Verordnung vom 20. November 1938 erweiterte sich die Zuständigkeit der Sondergerichte auf fast alle Straftatbestände. Mit Kriegsbeginn wurden weitere Verordnungen und Gesetze erlassen, die in den Zuständigkeitsbereich des Sondergerichts fielen, unter anderem die "Volksschädlingsverordnung", die "Kriegswirtschaftsverordnung", die "Verordnung über den Umgang mit Kriegsgefangenen" und die "Polenstrafrechtsverordnung".
Die Einrichtung von Sondergerichten beginnt in der Endphase der Weimarer Republik, als durch das Aufkommen der Nationalsozialisten die politisch motivierten Gewalttaten beträchtlich anstiegen. Mit Berufung auf die VO des Reichspräsidenten vom 6. Oktober 1931 wurden am 9. August 1932 (RGBI. I S. 404) die ersten Sondergerichte geschaffen. Bereits am 19. Dezember 1932 wurden diese jedoch wieder aufgelöst. Für den Landgerichtsbezirk Altona wurde damals ein eigenes Sondergericht beim Landgericht Altona eingerichtet. Die erhaltenen Verfahrensakten dieses Sondergerichts sind hier unter Nr. 7699-7733 verzeichnet.
Nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 und der Festigung der nationalsozialistischen Herrschaft nach den Reichstagswahlen vom 5. März 1933 wurde mit Verordnung vom 21. März 1933 das gesamte Reichsgebiet mit Sondergerichten für jeden Oberlandesgerichtbezirk überzogen (RGBI. I S. 136). Ausdrücklich wurde in dieser Verordnung die Zuständigkeit der Sondergerichte für Delikte festgelegt, die sich aus der "Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat" vom 21. März 1933 ableiten ließen. Da beide Verordnungen recht weit gefasst waren und einen großen Interpretationsspielraum zuließen, war mit Ihnen der Weg zu einer politischen Justiz geöffnet, mit der die neue Regierung ihre Herrschaft festigen und ausbauen konnte, da nun eine rechtliche Handhabe gegen nahezu jede Form von tatsächlichem oder auch nur vermeintlichem Widerstand gegeben war. Am 30. Dezember 1934 wurde die VO vom 21. März 1933 durch das "Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutze der Parteiuniformen" ("Heimtücke-Gesetz", RGBI. I S. 1269) ausgelöst.
Im Oberlandesgerichtsbezirk Kiel wurde das Sondergericht zunächst beim Landgericht Altona eingerichtet und am 1. April 1937 im Zuge der durch das Groß-Hamburg-Gesetz bedingten Neuordnung der gerichtlichen Zuständigkeiten zum Landgericht Kiel verlegt.
Die Verordnung vom 20. November 1938 (RGBI. I S. 1632) erweiterte die Zuständigkeiten der Sondergerichte beträchtlich. So konnte laut Artikel I dieser Verordnung Anklage beim Sondergericht erhoben werden, wenn durch "die Schwere oder die Verwerflichkeit der Tat oder die in der Öffentlichkeit hervorgerufenen Erregung die sofortige Aburteilung ... geboten ist". Die Ladungsfrist wurde auf 24 Stunden festgelegt (Artikel III). Damit war eine Anklageerhebung nach fast allen Straftatbeständen vor dem Sondergericht möglich.
Mit Kriegsbeginn wurde eine Reihe weiterer Verordnungen und Gesetze erlassen, die in den Zuständigkeitsbereich der Sondergerichte fielen. Bereits am 17. August 1938 war es im Zuge der allgemeinen Kriegsvorbereitungen durch die VO über das Sonderstrafrecht im Kriege und bei besonderem Einsatz (Kriegssonderstrafrechtsverordnung, RGBI. 1939 I S. 1455) möglich geworden, Fälle von Wehrkraftzersetzung zur Verhandlung vor das Sondergericht zu bringen. Die "Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen" vom 1. September 1939 (RGBI. I S. 1583) stellte das Abhören ausländischer Sender unter schwere Strafe. Von besonderer Bedeutung für die Aburteilung von Eigentumsdelikten war die "Verordnung gegen Volksschädlinge" vom 5. September 1939 (RGBI. I S. 1679). Mit zunehmenden Versorgungsschwierigkeiten der Zivilbevölkerung entwickelte sich eine neue Form der Kriminalität durch Schwarzhandel und Schiebergeschäfte. Zu ihrer Bekämpfung wurde die "Kriegswirtschaftsverordnung2 vom 4. September 1939 (RGBI. I S. 1609) und die "Verbrauchsregelungs-Strafverordnung" vom 6. April 1940 (RGBI. I S. 610, erweiterte Fassung vom 26. November 1941, RGBI. I S. 734) erlassen. Die "Verordnung zur Ergänzung der Strafvorschriften zum Schutz der Wehrkraft des Deutschen Volkes" vom 25. November 1939 (RGBI. I S. 2319) verfolgte den Tatbestand der Wehrmittelbeschädigung und fand auch Anwendung bei der Bestrafung von Frauen, die sexuelle Beziehungen zu Kriegsgefangen hatten. Da die Zahl der Kriegsgefangen, die im Reich zur Arbeit zwangsverpflichtet wurden, 1940 stark anstieg und gleichzeitig jeder soziale Kontakt zu diesen unterbunden werden sollte, erging am 11. Mai 1940 die "Verordnung über den Umgang mit Kriegsgefangenen" (RGBI. I S. 769), die nicht nur sexuelle Beziehungen, sondern nahezu jede Form des privaten Umgangs mit Kriegsgefangenen unter schwere Strafe stellte. Gegen die zum Arbeitseinsatz in der Wirtschaft und in der Landwirtschaft in immer größerer Zahl zwangsrekrutierten Arbeitskräfte aus Polen und anderen Gebieten Osteuropas erließ die Reichsregierung die sogenannte Polenstrafrechtsverordnung (VO über die Strafrechtspflege gegen Polen und Juden in den eingegliederten Ostgebieten vom 4. Dezember 1941, RGBI. I S. 759), die auch für geringe Vergehen hohe Strafen und in vielen Fällen die Todesstrafe vorsah.
Den bei der Staatsanwaltschaft beim Sondergericht geführten Verfahrensregistern ist eine beachtliche Anzahl von Todesurteilen zu entnehmen. Viele der dazugehörigen Prozessakten sind jedoch nicht mehr vorhanden, und es muss davon ausgegangen werden, dass sie bei Kriegsende vernichtet wurden: ein Beispiel dafür, dass die erhaltenen Akten kein vollständiges Bild über die Tätigkeit des Sondergerichts liefern; dennoch spiegeln sie die Zeit von 1932 bis 1945 wider. Ihr Quellenwert erschöpft sich nicht in der rechtshistorischen Auswertung, sondern liegt gerade auch in der Möglichkeit, mit Fragestellungen der "Alltagsgeschichte" an diese Akten heranzugehen. Verurteilungen nach dem Heimtücke-Gesetz erfolgten beispielsweise wegen Kritik oder auch nur verhaltenen Unmutsäußerungen über innen- und außenpolitische Maßnahmen der Regierung (z. B. Sammlungen für Organisationen der NSDAP, die Aufrüstung oder die Beteiligung am spanischen Bürgerkrieg). Auf die immer schwieriger werdende Ernährungslage im Reich weisen nicht nur die zahlreichen "Heimtücke-Fälle" wegen kritischer Bemerkungen über die Versorgungsmängel hin, sondern auch die große Anzahl von – meist gegen Bauern gerichtete – Strafverfahren wegen Schwarzschlachtungen. Ein beträchtlicher Anteil dieser Verfahren hat seinen Ursprung in der Denunziation durch Nachbarn und Bekannte. Kriegsbedingt war auch die hohe Zahl von Eigentumsdelikten (Unterschlagung von Feldpostsäckchen, Plünderungen in bombengeschädigten Häusern, Einbrüche in Luftschutzkeller, Betrug des Kriegsschäden-Amtes), Delikte, für die hohe Zuchthausstrafen oder gar die Todesstrafe verhängt wurden.
Die Verordnung zur Ergänzung und Änderung der Zuständigkeitsverordnung vom 29. Januar 1943 (RGBI. I S. 76) sah für Fälle von Wehrkraftersetzung und vorsätzlicher Wehrdienstentziehung die Verhandlung vor dem Volksgerichthof vor. Die beim Sondergericht Kiel anhängigen Verfahren wurden dazu zunächst an das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg abgegeben und von dort an den Volksgerichthof weitergeleitet. Der Volksgerichthof wiederum gab den größten Teil dieser Verfahren zur Verhandlung an das Hanseatische OLG zurück. Auffällig ist, dass seit 1943 nahezu alle Verfahren, die im weitesten Sinne als politisch anzusehen sind, diesen Weg gingen. Ein Teil dieser Verfahren wurde von der Staatsanwaltschaft beim Hanseatischen OLG im April 1945 an die Staatsanwaltschaft Kiel weitergeleitet, wo sie – nach Kriegsende – abgewickelt wurden. Für diese Abwicklung erhielten die Verfahren das neue Aktenzeichen 12 a O, das im Findmittel bei den entsprechenden Fällen vermerkt ist. Das dazugehörige Register ist unter der Archivsignatur LASH Abt. 358 Nr. 8377 nachgewiesen.
Die ansteigende Zahl der Vorverfahren und Prozesse bedingte eine ständige Erweiterung des Sondergerichts. Von 1933 bis zum 31.03.1941 gab es nur eine Geschäftsstelle (11 Son). Danach wurden weitere Kammern eingerichtet, deren Zuständigkeiten weitgehend den Landgerichtsbezirken entsprachen:
Abt. 11
21.03.1933 – 31.03.1941 Oberlandesgerichtsbezirk Kiel
01.04.1941 – 30.06.1942 LG-Bez. Kiel
01.07.1942 – 1945 Stadtkreis Kiel
Abt. 12
01.04.1941 – 30.06.1942 LG-Bez. Flensburg, Itzehoe, Lübeck
01.07.1942 – 31.10.1943 LG-Bez. Itzehoe, Lübeck
01.11.1943 – 1945 LG-Bez. Lübeck
Abt. 13
01.07.1942 – 1945 LG-Bez. Flensburg, Kiel (ohne Stadtkreis Kiel)
Abt. 14
01.11.1943 – 1945 LG-Bez. Itzehoe
Bestandsgeschichte
Der größte Teil der Kieler Sondergerichtsakten wurde im Oktober 1959 von der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Kiel an das Landesarchiv abgegeben (Acc. 51/1959). In den folgenden Jahren wurden noch weitere einzelne Verfahren abgegeben, soweit sie von den Justizbehörden nicht mehr benötigt wurden. Die Altonaer Sondergerichtsakten erhielt das Landesarchiv im Januar 1982 von der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hamburg (Acc. 4/1982). Aktenführende Behörde war – analog zu den Landgerichten – die zum Sondergericht gehörige Staatsanwaltschaft.
Im Archivbestand sind die Akten in der Reihenfolge der vom Sondergericht vergebenen Aktenzeichen verzeichnet. Durch das Beibehalten der alten Ordnung ließen sich Springnummern allerdings nicht vermeiden. Die Akten des Altonaer Sondergerichts von 1932 stehen am Beginn, dann folgen diejenigen der Sondergerichte Altona und Kiel von 1933 bis 1945.
Innerhalb der einzelnen Jahrgänge sind die Vorverfahren bzw. reinen Ermittlungsverfahren vorangestellt, ihnen folgen die Strafverfahren (Beispiel: 11 Son Js 1937, 11 Son KLs 1937, 11 Son KMs 1937). Die noch erhaltenen Verfahrensregister der einzelnen Abteilungen und Jahrgänge sind im Archivbestand unter den Signaturen LASH Abt. 358 Nr. 8312 ff zu finden. Sie weisen auch diejenigen Verfahren nach, deren Akten verlorengegangen sind.
Bei der Titelaufnahme steht an erster Stelle der Name des Beschuldigten mit Angaben über Familienstand, Beruf, Nationalität und Wohnort. Die Nationalität ist im Personenregister zusammen mit dem Namen ausgeworfen. Bei von unbekannten Tätern begangenen Delikten wird der Geschädigte mit dem Zusatz z. N. (zum Nachteil) genannt. Der Wohnort erscheint mit seiner Kreiszugehörigkeit im Ortsregister; wenn der Name einer Stadt mit dem des Kreises identisch ist, wird der Kreis nicht genannt (z. B. Pinneberg, Eckernförde). Kleinere Orte außerhalb Schleswig-Holsteins sind durch die Angabe der jeweiligen preußischen Provinz bzw. des Staates näher gekennzeichnet; bei größeren, allgemein bekannten Städten wurden auf eine Spezifizierung verzichtet.
Nach den Personalien folgt der Ermittlungsgegenstand bzw. die Anklage, wobei zunächst die Verordnung aufgeführt werden, die die Zuständigkeit des Sondergerichts bedingen (z. B. Heimtücke-Gesetz). Danach folgen, soweit vorhanden, die einschlägigen Paragrafen des Strafgesetzbuches ("in Verbindung mit §"): Einzelne Verordnungen sind verkürzt zitiert, der jeweils vollständige Titel ist aus der Übersicht ab S. IX ersichtlich. Der eigentliche Straftatbestand wird kurz beschrieben (z. B. abfällige Äußerungen über Hitler).
Bei den Strafverfahren folgen nun das Aktenzeichen des Vorverfahrens (Js) und das Urteil. Bei Todesurteilen ist der Tag der Vollstreckung angegeben. Einweisungen in Konzentrationslager werden genannt, soweit sie den Akten zu entnehmen waren – sicherlich nur ein Bruchteil der tatsächlichen Einweisungen. Im Ortsregister sind die einzelnen Konzentrationslager sämtlich unter KZ aufgeworfen.
Eine mögliche Weiterführung der Verfahren nach dem Ende des Dritten Reiches (Straftilgung, Begnadigung etc.) blieb bei der Verzeichnung unberücksichtigt. In den Angaben zur Laufzeit sind aber auch die nach 1945 angewachsenen Vorgänge enthalten.
Umfangreichere Verfahren, die aus mehreren Aktenbänden bestehen, erscheinen im Findbuch unter der Bestellnummer des ersten Aktenbandes. Auf die weiteren Aktenbände des Verfahrens wird dann am Schluss des Titels hingewiesen (* Fortsetzung Nr.). In solchen Fällen müssen sämtliche genannten Nummern bestellt werden. Die mögliche Verbindung mehrerer Verfahren, z. B. durch denselben Beschuldigten, ist durch Querverweise kenntlich gemacht.
Enthält
Der Bestand enthält auch die Akten der Staatsanwaltschaft des von August bis November 1932 beim Landgericht Altona eingerichteten Sondergerichts.
Literatur
(Verzeichnis der im Bestand genannten Gesetze und Verordnungen (einschließlich Kurztitel))
Gesetz gegen den verbrecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 09.06.1884 (RGBl. S. 61) - Sprengstoffgesetz
Gesetz über Schusswaffen und Munition vom 12.04.1928 (RGBl. I, S. 143)
Gesetz gegen Waffenmissbrauch vom 28.03.1931 (RGBl. I, S. 77)
Verordnung zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 28.03.1931 (RGBl. I, S. 79)
Vierte Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finan-zen und zum Schutz des inneren Friedens vom 08.12.1931 (RGBl. I, S. 699)
Anordnung der Regierungspräsidenten zu Schleswig betr. Schusswaffen vom 19.12.1931 (Amtsblatt Schl.-Holst. S. 385)
Verordnung gegen politische Ausschreitungen vom 14.06.1932 (RGBl. I, S. 297)
Verordnung gegen politischen Terror vom 09.08.1932 (RGBl. I, S. 403)
Verordnung zum Schutze des deutschen Volkes vom 04.02.1933 (RGBl. I, S. 35)
Verordnung zum Schutz von Volk und Staat vom 28.02.1933 (RGBl. I, S. 83)
- VO vom 28.02.1933
Verordnung gegen Verrat am Deutschen Volke und hochverräterische Umtriebe vom 28.02.1933 (RGBl. I, S. 85)
Verordnung zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung vom 21.03.1933 (RGBl. I, S. 135)
Gesetz zur Abwehr politischer Gewalttaten vom 04.04.1933 (RGBl. I, S. 162)
Gesetz gegen Verrat der Deutschen Volkswirtschaft vom 12.06.1933 (RGBl. I, S 360)
Gesetz gegen die Neubildung von Parteien vom 14.07.1933 (RGBl I, S. 479)
Gesetz zur Gewährleistung des Rechtsfriedens vom 13.10.1933 (RGBl. I, S. 723)
Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen vom 20.12.1934 (RGBl. I, S. 1269) - Heimtückegesetz
Bekanntmachung des Gesetzes über die Devisenbewirtschaftung und der Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Devisenbewirtschaftung vom 04.02.1935 (RGBl. I, S. 105) - Devisengesetz
Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15.09.1935 (RGBl. I, S. 1146)
- Blutschutzgesetz
Gesetz zur Verhütung von Missbräuchen auf dem Gebiete der Rechtsberatung vom 13.12.1935 (RGBl. I, S. 1478)
Gesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen vom 17.01.1936 (RGBl. I, S. 17) - Lebensmittelgesetz
Verordnung über das Verbot von Preiserhöhungen vom 26.11.1936 (RGBl. I, S. 955)
Gesetz gegen Wirtschaftssabotage vom 01.12.1936 (RGBl. I, S. 999)
Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen vom 01.07.1937 (RGBl. I, S. 725)
Gesetz gegen die Schwarzsender vom 24.11.1937 (RGBl. I, S. 1298)
Verordnung über das Sonderstrafrecht im Kriege und bei besonderem Einsatz vom 17.08.1938 (RGBl. 1939 I, S. 1455) - Kriegssonderstrafrechtsverordnung
Gesetz über Viehzählungen vom 31.10.1938 (RGBl. I, S. 1532)
Gesetz über die Devisenbewirtschaftung vom 12.12.1938 (RGBl. I, S. 1733)
Verordnung zur Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung vom 13.02.1939 (RGBl. I, S. 206)
Verordnung über Strafen und Strafverfahren bei Zuwiderhandlungen gegen Preis-vorschriften vom 03.06.1939 (RGBl. I, S. 999)
Verordnung über die öffentliche Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Erzeug-nissen vom 27.08.1939 (RGBl. I, S. 1521)
Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen vom 01.09.1939 (RGBl. I, S. 1683)
Verordnung über die Beschränkung des Arbeitsplatzwechsels vom 01.09.1939 (RGBl. I, S. 1685)
Kriegswirtschaftsverordnung vom 04.09.1939 (RGBl. I, S. 1609) - KWVO
Verordnung gegen Volksschädlinge vom 05.09.1939 (RGBl. I, S. 1679) - VVO
Verordnung über die öffentliche Bewirtschaftung von Getreide, Futtermitteln und sonstigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen vom 07.09.1939 (RGBl. I, S. 1705)
Verordnung über die öffentliche Bewirtschaftung von Tieren und tierischen Erzeugnissen vom 07.09.1939 (RGBl. I, S. 1714)
Verordnung zum Schutz gegen jugendliche Schwerverbrecher vom 04.10.1939 (RGBl. I, S. 2000)
Verordnung zur Ergänzung der Strafvorschriften zum Schutz der Wehrkraft des Deutschen Volkes vom 25.11.1939 (RGBl. I, S. 2319) - VO zum Schutz der Wehrkraft des Deutschen Volkes
Verordnung gegen Gewaltverbrecher vom 05.12.1939 (RGBl. I, S. 2378)
Verordnung zum Schutz des Reichsarbeitsdienstes vom 12.03.1940 (RGBl. I, S. 485)
Verordnung zum Schutz der Metallsammlung des Deutschen Volkes vom 29.03.1940 (RGBl. I, S. 565)
Verordnung über Strafen und Strafverfahren bei Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften auf dem Gebiet der Bewirtschaftung bezugsbeschränkter Erzeugnisse vom 06.04.1940 (RGBl. I, S. 610) und vom 26.11.1941 (RGBl. I, S. 734) -Verbrauchsregelungs-Strafverordnung
Verordnung über den Umgang mit Kriegsgefangenen vom 11.05.1940 (RGBl. I, S. 769)
Gesetz zur Änderung des Reichsstrafgesetzbuches vom 04.09.1941 (RGBl. I, S. 549)
Verordnung über die unbestimmte Verurteilung Jugendlicher vom 10.09.1941 (RGBl. I, S. 567)
Verordnung über die Strafrechtspflege gegen Polen und Juden in den eingegliederten Ostgebieten vom 04.12.1941 (RGBl. I, S. 759) - Polenstrafrechtsverordnung
Verordnung zum Schutze der Sammlung von Wintersachen für die Front vom 23.12.1941 (RGBl. I, S. 797)
Verordnung zur Erweiterung und Verschärfung des strafrechtlichen Schutzes gegen Amtsanmaßung vom 09.04.1942 (RGBl. I, S. 174)
Verordnung zur Sicherstellung des Brotgetreidebedarfs vom 05.07.1942 (RGBl. I, S. 443)
Verordnung zur Wohnraumversorgung der luftkriegsbetroffenen Bevölkerung vom 21.06.1943 (RGBl. I, S. 355)
Verordnung zum Schutz der Sammlung von Kleidung und Ausrüstungsgegenständen für die Wehrmacht und den Deutschen Volkssturm vom 10.01.1945 (RGBl. I, S. 5)
Siehe
Korrespondierende Archivalien
Die Akten der Staatsanwaltschaft bei dem Sondergericht Flensburg aus dem Jahre 1932 befinden sich in Abt. 354.
Weitere Angaben (Bestand)
Umfang in lfd. M.
100